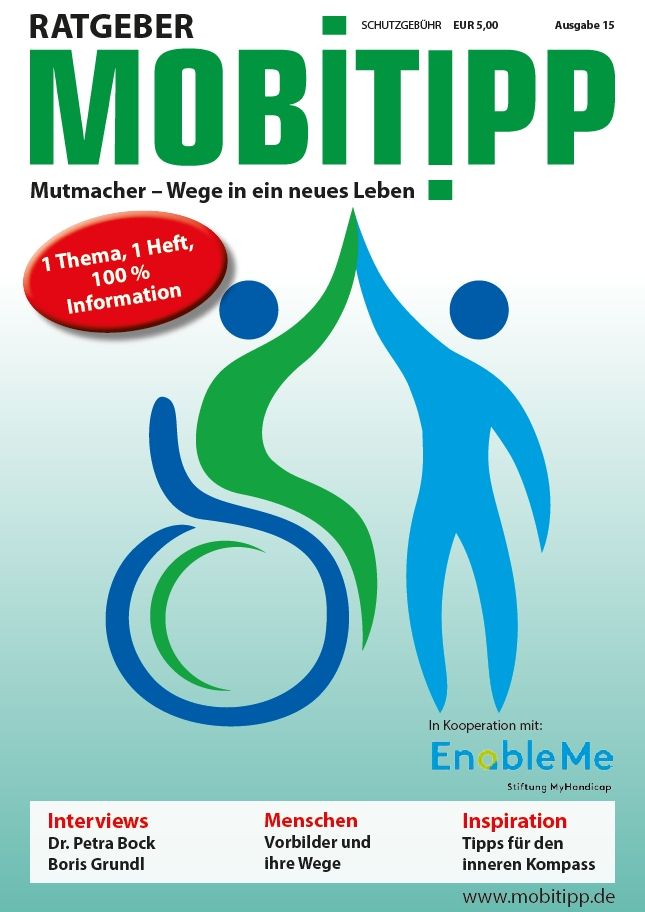MOBITIPP: Frau Schiedermaier, ist der Umzug eine Folge Ihrer eingeschränkten Mobilität nach den Unterschenkel-Amputationen?
Julia Schiedermaier: Unsere Dachgeschoss-Wohnung in einem Bauernhof in Aying bei München ist zwar sehr idyllisch, aber nur über 32 Stufen zu erreichen. Mein Mann und ich haben deshalb die Chance genutzt, innerhalb der Gemeinde ein neues, komplett barrierefreies Haus zu bauen. Dadurch können wir mit unserem Sohn und unserer Tochter im vertrauten Umfeld bleiben. Das war ein Glücksfall.
MOBITIPP: Haben Sie sich schon an die Prothesen gewöhnt?
Julia Schiedermaier: Das Laufen klappt jetzt schon recht gut. Die Reha im August hat meine Mobilität enorm verbessert. Bis dahin musste ich jede Bewegung, die zuvor automatisch ablief, bewusst steuern. Diese Aufmerksamkeit belegt im Gehirn extrem viel Arbeitsspeicher und raubt einem die ganze Energie, die man vorher für anderes hatte. Inzwischen haben sich neue Automatismen eingespielt. Dadurch habe ich den Kopf freier und bin abends nicht mehr so erschöpft.
Aber ich habe mir auch vorgenommen, dass ich mir zugestehe, das Geschehene in meinem ureigenen Tempo zu verarbeiten. Sich Druck zu machen, weil man wieder funktionieren will oder weil andere angeblich alles besser und schneller wegstecken, ist der falscheste Weg. Man hat auch nicht alles selbst in der Hand. Es ist ein Auf und Ab und manchmal auch ein Schritt zurück.
MOBITIPP: Sie wurden innerhalb von knapp zwei Jahren bisher 23-mal operiert, waren monatelang in Krankenhäusern und zur Reha. Hat Ihre Familie schon zu einem neuen Alltag gefunden?
Julia Schiedermaier: Der klassische Alltag mit schulpflichtigen Kindern – aufstehen, gemeinsam frühstücken, Kinder für die Schule fertigmachen – hat sich normalisiert. Aber es hat sich darüber hinaus auch viel verändert, weil ich heute manches bewusster mache oder bewusster nicht mehr mache.
MOBITIPP: Können Sie das näher erklären?
Julia Schiedermaier: Für mich war der Einschnitt im Frühjahr 2019 wie ein riesiger Reset-Knopf, der praktisch alles auf null gestellt hat. Ich habe darin eine Chance gesehen, mein Leben noch einmal komplett neu auszurichten und dabei zu entscheiden, was rein soll und was ich nicht mehr haben will.
Im Grunde geht es da um die gleichen strategischen Überlegungen und Antworten, wie ich sie als Coach und Trainerin in der Burn-out-Prävention mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erarbeite: Wie schaffe ich es, aus Alltagsmustern und Verhaltensweisen auszusteigen, die mir nicht guttun? Solche Veränderungen fallen schwer. Und natürlich hätte ich mir andere Umstände gewünscht. Aber ich habe mich entschieden, diesen Einschnitt als Chance zur Neuorientierung zu sehen. Wie ein weißes Blatt, das man neu beschreiben kann.
MOBITIPP: Wie haben Sie den Rollenwechsel von der Macherin zu einer hilfsbedürftigen Patientin erlebt?
Julia Schiedermaier: Das war schon ein krasser Rollenwechsel. Hilfe anzunehmen, passte nicht zu meinem Selbstverständnis. Inzwischen kann ich Aufgaben leichter abgeben. Auslöser für mein Umdenken war ein Buch von John Strelecky. Darin sagt der Mann sinngemäß zu einer Frau, die nicht um Hilfe bitten mag: ,Das ist egoistisch, wenn man nicht bittet, weil es dem anderen guttut, etwas für Dich zu tun.‘ Im Grunde kennen wir alle beide Seiten. Doch unsere Leistungsgesellschaft betrachtet Hilfsbedürftigkeit als Schwäche. Dabei ist es eine Win-win-Situation.
MOBITIPP: Was erleben Sie als größten Verlust?
Julia Schiedermaier: In einigen Lebensbereichen vermisse ich es sehr, etwas spontan machen zu können: morgens mal eben aus dem Bett zu springen oder mit der Familie etwas zu unternehmen, ohne vorher abklären zu müssen, ob das für mich machbar ist. Auch mich spontan ins Auto setzen zu können, vermisse ich sehr. Wir klären gerade, ob und unter welchen Voraussetzungen ich wieder Autofahren kann. In ländlichen Regionen ist man ohne Auto abgehängt. Insgesamt habe ich aber einen guten Umgang mit meiner eingeschränkten Mobilität gefunden. Ich hadere merklich weniger. Davon wachsen meine Beine auch nicht mehr nach.
MOBITIPP: Hat Ihnen Ihr beruflicher Hintergrund als Coach und Trainerin bei der Bewältigung dieser extremen Lebensveränderung geholfen?
Julia Schiedermaier: Das war ein ausschlaggebender Faktor. Ich habe zuvor schon sehr lange in meinen Seminaren mit Mentaltechniken gearbeitet und weiß, wozu unser Gehirn in der Lage ist. Das Negative bewusst auszublenden und mich auf das Positive zu konzentrieren, hat mir sehr geholfen. Ich habe mir zum Beispiel schöne Erlebnisse mit der Familie ins Gedächtnis gerufen. Es gab natürlich auch Momente, in denen es mir schlecht ging. Aber dann stelle ich mir immer die Frage, ob ich etwas ändern kann und ob sich der Einsatz lohnt. Wenn nichts hilft, haben wir immer noch die Chance, eine unveränderliche Situation so zu bewerten, dass wir darauf gut aufbauen können.
MOBITIPP: Wie hat Ihre Familie und insbesondere Ihre Kinder ihre plötzliche lebensgefährliche Erkrankung und Ihre lange Abwesenheit verkraftet?
Julia Schiedermaier: Meine Familie war die wichtigste Kraftquelle. Mein Mann hat mich nahezu täglich besucht. Um die Kinder kümmerten sich alle vier Großeltern. Unsere damals elfjährige Tochter hat mein pragmatisches Naturell und ist mit großer Zuversicht ausgestattet. Unser Sohn war damals neun Jahre alt und hätte meine Nähe mehr gebraucht. Deshalb haben wir vorsorglich zeitweise eine Kinderpsychologin eingeschaltet. Auch die Schule war informiert. Rückblickend kann man sagen, dass unsere Kinder in dieser Zeit einen enormen Entwicklungsschub gemacht haben. Auch wenn wir ihnen diese Erfahrungen natürlich gern erspart hätten.
MOBITIPP: Sie sind relativ schnell nach Ihrer Heimkehr mit Ihrem Blog www.juliaschiedermaier.de an die Öffentlichkeit gegangen.
Julia Schiedermaier: Meine Triebfeder war die Erkenntnis, dass eine Sepsis vermeidbar ist, wenn sie rechtzeitig diagnostiziert wird. Das bedarf aber sehr viel mehr Aufklärung und Prävention, sowohl für das medizinische Personal als auch für die Bevölkerung. Mit meinem Blog will ich meinen Beitrag leisten.
Bei mir wurde eine Streptokokkeninfektion nicht erkannt, weil ihre Symptome in den Symptomen einer Influenza untergingen. In meinem Fall bildete sich dann ein Eiterherd von eineinhalb Litern zwischen Bauchfell und Lungenfell. So weit müsste es nicht kommen, wenn bei Patienten mit Sepsis-ähnlichen Symptomen standardmäßig eine Abklärung erfolgen würde.
Auf meine Blog-Texte habe ich übrigens bisher nur positive Reaktionen bekommen – Zuspruch, Erfahrungen, Themenanregungen. Das motiviert mich auch zum Weitermachen.